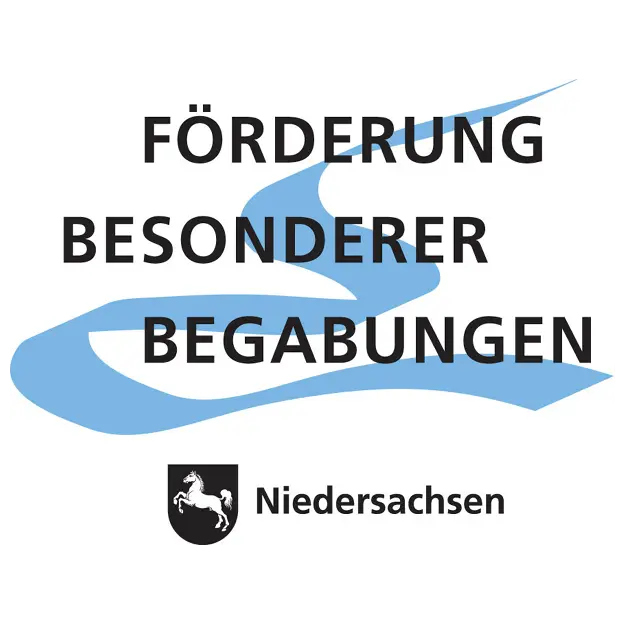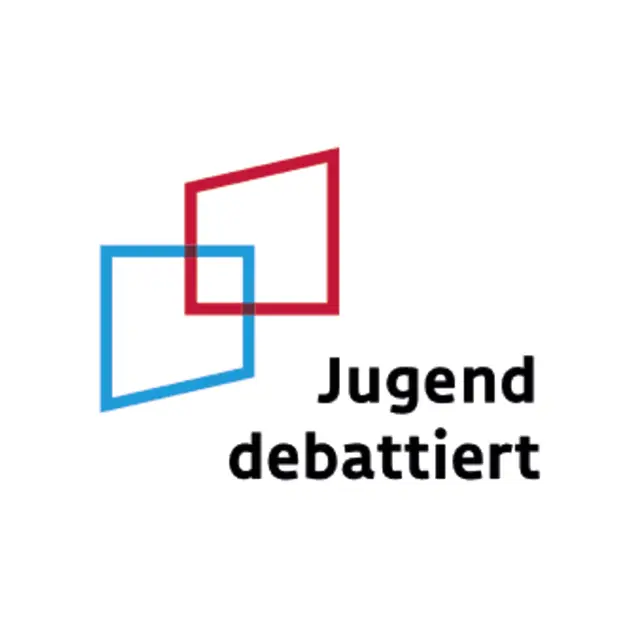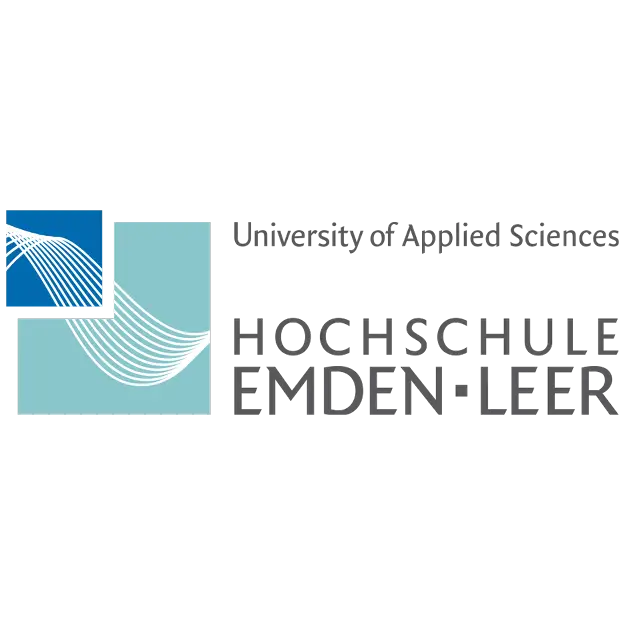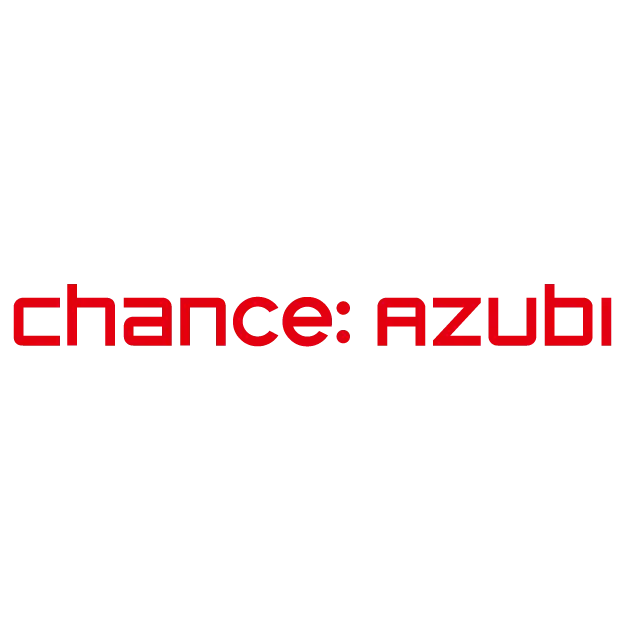Philosophie am TGG
Fachkollegium: Martin Bode, Hauke Bracht, Rabea Franiek, Jolien Schrader
Fachgruppenvorsitzender: Martin Bode
Vorstellung des Fachs
Was Philosophie (wörtlich so viel wie „Liebe zur Weisheit”) ist, ist selbst ein philosophisches Problem. Eine mögliche Position wäre es, zu sagen, dass Philosophie aus zwei Fragen besteht:
- What do you mean? – Was meinen Sie mit dem, was Sie da sagen?
- How do you know? – Woher glauben Sie das zu wissen, was Sie da sagen?
Oder man orientiert sich an Kant, der das Arbeitsfeld der Philosophie mit folgenden Fragen absteckte:
- Was kann ich wissen?
- Was soll ich tun?
- Was darf ich hoffen?
- Was ist der Mensch?
Fest steht jedenfalls, dass ursprünglich alles auf Argumenten beruhende Nachdenken Philosophie genannt wurde und sie die Einzelwissenschaften wie die Biologie, Chemie, Physik, aber auch die Grammatik, Logik und Mathematik aus sich heraus entlassen hat.
Als Einführung in philosophisches Denken könnten folgende, in der Schülerbibliothek ausleihbare Schriften dienen:
- Bertrand Russell: Probleme der Philosophie
- Thomas Nagel: Was bedeutet das alles?
Das Fach Philosophie wird nur in der gymnasialen Oberstufe unterrichtet und gehört zum Aufgabenfeld B.
Philosophie wird am TGG – auch als Alternative zum Unterricht im Fach Religion – im 11. Jahrgang als zweistündiger Kurs und in den Jahrgängen 12 und 13 als dreistündiger Kurs angeboten. Es kann als P4- oder P5-Prüfungsfach gewählt werden.
Im 11. Jahrgang wird pro Schulhalbjahr eine Klausur geschrieben, in den Jahrgängen 12 und 13 drei pro Schuljahr; bei zwei Klausuren ist die Gewichtung Schriftlich : Mitarbeit = 50% : 50%, bei nur einer Klausur 40% : 60%.
Im Fach Philosophie gibt es kein Zentralabitur.
_______________
Inhalte
Jahrgang 11: Einführung
- Was ist Philosophie?
- Gibt es etwas, das wir zu tun verpflichtet sind?
- Können wir überhaupt etwas wissen?
- Wer sind wir?
Jahrgang 12: Schwerpunkt Praktische Philosophie
- Ethik (utilitaristisch, teleologisch, deontologisch)
- Staats-, Geschichts-, Rechts-, Sozial- und Kulturphilosophie
- Sprachphilosophie
- Anthropologie – Sinnfrage
- Zukunftsfragen
Jahrgang 13: Schwerpunkt Theoretische Philosophie
- Erkenntnistheorie, Logik, Wissenschaftstheorie
- Ontologie, Metaphysik, Religionsphilosophie
- Naturphilosophie
Mögliche Kursfolgen
[Die dargestellten Kursfolgen in den Jahrgängen 12 und 13 sind als Beispiele zu verstehen; eine Veränderung auf Basis der Rahmenrichtlinien ist möglich.]
Semester: Das Gute im moralischen und außermoralischen Sinn
Semester: Geist – Gehirn – Bewusstsein
Semester: Auf der Suche nach Gewissheit
Semester: Die Reichweite menschlicher Freiheit
Grundlage für den Philosophieunterricht sind:
- NIEDERSÄCHSISCHER KULTUSMINISTER (Hrsg.) „Rahmenrichtlinien für das Gymnasium. Philosophie. Gymnasiale Oberstufe“, Hannover 1985
- Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Philosophie (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 i.d.F. vom 16.11.2006)
Methodische Fertigkeiten
Ausgehend von den in der Sekundarstufe I in verschiedenen Fächern erworbenen Fertigkeiten werden in der gymnasialen Oberstufe graduell steigernd im Sinne eines Propädeutikums wesentliche fachspezifische und fächerübergreifende Erweiterungen und Vertiefungen des Methodeninventars vorgenommen, die zu einer angemessenen Vorgehensweise im Fach Philosophie nach Vorgabe der Rahmenrichtlinien hinführen sollen.
a) fächerübergreifend
- Führen von unterrichtsbegleitenden Dossiers und thematischen Arbeitsmappen
- Arbeitsorganisation: inhaltsorientierte Zeitplanung, arbeitsteiliges Vorgehen, Teamarbeit (Bereithalten aller Ergebnisse von allen Gruppenmitgliedern)
- interaktive Arbeitsformen (Entwicklung und Ausbau von Dialogfähigkeit, Kooperationsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit)
- Informationsbeschaffung, Umgang mit Nachschlagewerken, Fachliteratur, neuen Medien
- Angabe von Quellen
- Strukturierung, Begriffsarbeit (terminologische Sicherheit, Präzisierung, sachliche Transparenz)
- Text- und Materialauswertung (Vergleich, Beurteilung, Transfer)
- Arbeit mit Texten (genaue Texterfassung und -wiedergabe, sprachliche und stilistische Angemessenheit im Ausdruck)
- Arbeit ohne Text (Problemorientierung, Projektarbeit, Medieneinsatz)
- Vortrags- und Präsentationsformen (Stichwortzettel, Informations- bzw. Thesenpapiere, freier Vortrag, medienunterstützt, multimedial)
- Ausbildung von Schreib- und Diskursfähigkeit
- Schriftliche Beurteilungen von Problemen und Sachverhalten
- Einübung von abstrahierendem und generalisierendem Denken
- Klärung von Voraussetzungen und Offenlegung von verdeckten Implikationen
b) fachspezifisch
- Umgang mit Differenzierung und Problematisierung des Wahrheitsbegriffs
- Problematisierung des Selbstverständlichen (= Philosophie)
- Zuordnung der Fragen zu philosophischen Teildisziplinen
- Umgang mit Definitionen, Thesen, Voraussetzungen, Argumenten, Beweisen, logischen Schlussfolgerungen
- Umgang mit dem Unterschied: speziell – allgemein; konkret – abstrakt
- Fähigkeit zur grundsätzlichen Arbeit, zur komplexen Arbeit, zu systemhaftem Denken (= in Zusammenhängen)
- Differenzierung von Glauben, Denken, Wissen
- Einübung in eigenständiges, folgerichtiges Denken (Problematisierung, Bestimmung des eigenen Standortes)
- Erkennen der Argumentationsstruktur (Isolierung von Thesen und ihrer Begründungen)
Beschlossen von der Fachkonferenz Philosophie am 4. Juli 2020